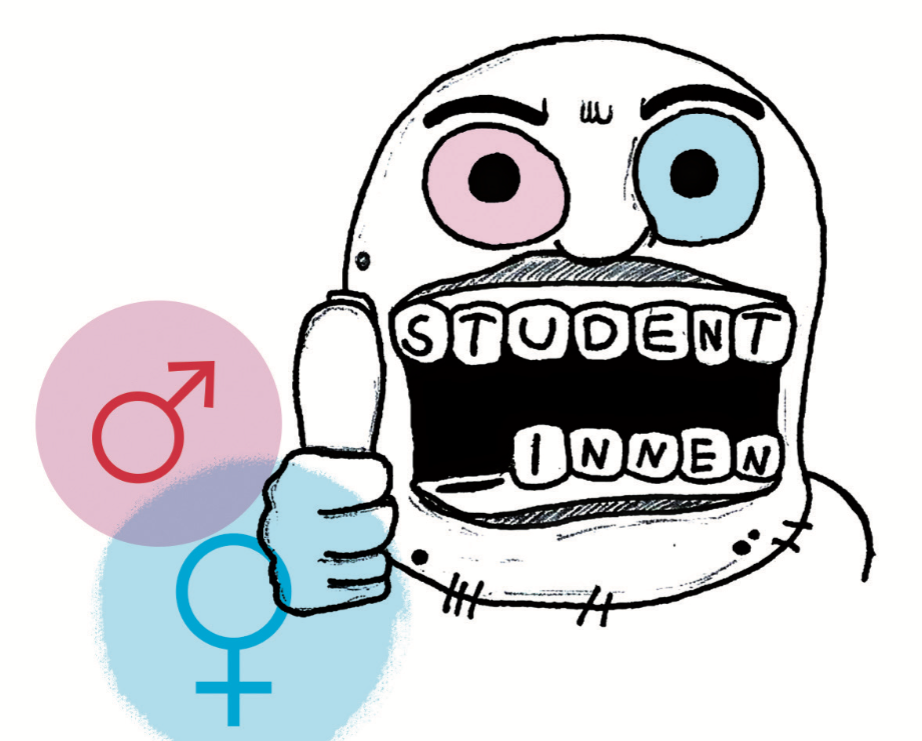Bürgerinitiative – Fast jeder Bonner Studierende saß schonmal im Café Blau, hat im Blow Up gefeiert oder eine Hausarbeit in einem Copy-Shop im Viktoriakarree drucken lassen. Das könnte bald vorbei sein, wenn dort ein Einkaufszentrum entsteht. Doch: Die Anwohner wehren sich.
von Johanna Dall’Omo

(Foto: Alexander Grantl / AKUT)
Kleine Geschäfte mit Herz oder große Konsumketten? Diese Frage stellt sich in Bonn zurzeit an fast jeder Ecke. Zuerst musste die Buchhandlung Bouvier schließen, dann verlor Bonn sein traditionsreiches Schreibwarengeschäft Carthaus, das Café Göttlich und vor kurzem auch das Café Goldbraun. Die Gründe für die Schließungen mögen unterschiedlich gewesen sein und doch tragen sie dazu bei, dass das Bonner Stadtbild sich wandelt. Die nächste große Veränderung, in unmittelbarer Nähe zu unserer Uni, soll das Einkaufszentrum »Kaufhaus Viktoria« sein, das im Viktoriakarree entstehen könnte. Dieser Fall spaltet seit Monaten die Gemüter. Insbesondere zeigt er aber, was Bürger bewegen können, wenn sie sich für ihren Lebensraum, ihre Geschäfte und ihre Existenz einsetzen.
Begonnen hat alles am 18.06.2015, als der Bonner Stadtrat mit mehrheitlichem Beschluss für den Verkauf der städtischen Grundstücke des Viktoriakarrees an eine Tochtergesellschaft der SIGNA stimmte. Diese plant dort eben jenes »Kaufhaus Viktoria«. Problematisch ist, dass die SIGNA die Ausschreibung für dieses Bauprojekt mit nur 2,5 von 6 Punkten gewonnen hat. In der Uni wäre man damit gnadenlos durchgefallen. Da keiner der beiden Bewerber die Erwartungen des Rates voll erfüllte, sprachen sich u. a. die Grünen, die dagegen stimmten, für eine Aufhebung der Ausschreibung aus. Aber die SIGNA bekam den Zuschlag, so war sie wohl von den Beiden das kleinere Übel. Im Folgenden gab es Anschuldigungen der Grünen, die Stadt hätte dem Verkauf und somit der Mall schon seit Jahren zugearbeitet. Hierfür spricht, dass die SIGNA schon seit 2012 auf ihrer Internetseite das »Kaufhaus Viktoria« bewirbt. Auch früher geriet Österreichs größtes privat geführtes Immobilienunternehmen immer wieder in die Schlagzeilen. Die undurchsichtigen Strukturen der Firma, der unter anderem die Karstadt Warenhaus GmbH gehört, sorgen immer wieder für Verdächtigungen. So sollen z.B. innerhalb der SIGNA-Gruppe Immobilien gewinnbringend hin- und hergeschoben werden. Nachzuweisen ist jedenfalls, dass die SIGNA Steuern über Luxemburg hinterzogen und so gespart hat. 2012 wurde Gründer René Benko außerdem wegen Korruption verurteilt, er hatte versucht ein Gerichtsverfahren mit Schmiergeldern zu seinen Gunsten zu manipulieren. Man kann nicht genau sagen, was passiert ist, aber dieses Projekt bietet definitiv Konfliktpotenzial.
Um das Einkaufszentrum zu verhindern und das Viertel zu retten, gründeten die Menschen, die dort leben und arbeiten, die »Viva Viktoria!«-Initiative. Es gehe ihnen hierbei nicht nur um die bloße Ablehnung des Einkaufszentrums, sondern um die Tatsache, dass die Bonner Bürger an dieser Entscheidung in keiner Weise beteiligt wurden. Um dies nachzuholen hat die Gruppe ein Bürgerbegehren angemeldet. Mit einer bestimmten Anzahl an Stimmen aus der Bevölkerung, in diesem Fall knapp 10.000 Unterschriften, kann die Entscheidung des Rates angezweifelt werden. Ziel ist es, dass der Rat seinen Entschluss zurücknimmt und anschließend, gemeinsam mit den Bürgern, an neuen Konzepten für das Viktoriakarree arbeitet. Sollte der Rat dennoch daran festhalten, kommt es zu einem Bürgerentscheid, bei dem alle Wahlberechtigten Bonns über die Zukunft des Viertels entscheiden könnten.
Und so wurden die letzten Wochen fleißig Unterschriften gesammelt, es gab wöchentlich Demos, eine Internet- und eine Facebookseite mit allen wichtigen Informationen. Sogar ein Lied wurde zu Ehren des Viktoriakarrees gedichtet. Die Melodie dazu kommt vom bekannten Karnevalslied »Viva Colonia«: »Da simmer dabei, dat is priima, Viva Viktoria! Wir lieben das Blow Up, das Bergfelds und das Blau! Wir brauche’ keine Shopping Mall, dat wisst ihr janz jenau!«
Die letztendlich 18.828 gesammelten Unterschriften beweisen, dass viele Bonner hinter der Idee von »Viva Viktoria!« stehen. Nach dem Einreichen der Dokumente bittet ein offener Brief den Stadtrat, den Stimmen der Bürger nachzukommen und gemeinsam an einer Zukunft des Viktoriakarrees zu arbeiten. Hierfür tüftelt die Initiative mit einer Projektgruppe schon an einem neuen Konzeptvorschlag. Der Brief soll aber auch die Entschlossenheit der Initiative zeigen, im Ernstfall auch den Bürgerentscheid anzugehen.
Neben der Tatsache, dass die Bürger bei diesem Verkauf nicht einbezogen wurden, geht es »Viva Viktoria!« auch um das, was das »Kaufhaus Viktoria« für das Viertel bedeuten würde. In einer Pressemitteilung der Gruppe heißt es: »Wir wenden uns gegen eine Totalüberbauung des gesamten Viertels und seine radikale Durchkommerzialisierung auf Kosten der jetzigen NutzerInnen.«
Argumente für oder gegen ein Einkaufszentrum in Sichtweite der Universität gibt es viele. So soll die Uni dort beispielsweise eine große neue philologische Bibliothek bekommen. Damit will SIGNA der Bedeutung Bonns als Studierendenstadt nachkommen. Unter dem Karree soll außerdem eine Tiefgarage entstehen, die mit der Marktplatzgarage verbunden werden soll. Die Kosten dafür soll zum großen Teil der Investor tragen. So kann der Verkehr auf der Stockenstraße und der Rathausgasse reduziert werden. Eine neue Ladenpassage, neue Wohnungen und viele neue Läden, wie die zu erwartende Elektronikmarktkette mit dem Planetennamen, klingen für manche erst einmal verlockend. Und doch gibt es laut »Viva Viktoria!« auch viele Nachteile. Ein solcher Komplex werde das Bild der Uni und deren Umgebung deutlich verändern. Der Grüne Politiker Hartwig Lohmeyer gab schon beim Verkauf die Höhe der geplanten Mall zu bedenken: diese werde das Uni-Hauptgebäude um einiges überragen. Auch das studentische Leben würde sich verändern. Statt im Café Blau mit Kommilitonen in der Sonne zu sitzen, gäbe es einen Coffee to go bei einer anonymen Café-Kette. Mit dem Blow Up verschwindet eine weitere Möglichkeit mit Freunden abends wegzugehen, ausgerechnet in Bonn, wo das Nachtleben für Studenten schon jetzt wenig zu bieten hat. Solche studentischen Institutionen müssten anderen Geschäften weichen.
Die Pläne der Shoppingmall sehen außerdem vor, dass 27 der 70 Wohnungen im Viertel wegfallen sollen. Schwierig im so schon hart umkämpften Wohnungsmarkt der Innenstadt. Es ist abzusehen, dass auch der Einzelhandel in der Innenstadt darunter leiden wird, wenn man die Shopping Mall dank Tiefgarage und großem Angebot nicht mal mehr verlassen muss. Es sind dann wohl weitere Schließungen in der Innenstadt zu befürchten. Dieser Meinung ist auch Grünen-Politiker Lohmeyer. Die Realisierung des SIGNA-Entwurfes würde die Bonner Innenstadt nicht attraktiv erweitern, sondern stattdessen eine stadtinterne Konkurrenz bedeuten, die den Einzelhändlern in der City zusätzlich das Leben schwer macht.
Das Viktoriakarree hat aktuell, neben Gastronomie und Einzelhandel, auch noch einiges mehr zu bieten, was es erhaltenswert macht. So gibt es z.B. das Stadtmuseum und die Gedenkstätte für Opfer des Nationalsozialismus, für die ebenfalls ein Umzug vorgesehen wäre. Auch das große denkmalgeschützte Fenster des Viktoriabades ist einmalig und sollte unbedingt gewürdigt werden. Die SIGNA sieht zwar vor, das Fenster von innen zu beleuchten, nach ihren Plänen würden sich dahinter jedoch keine Geschäfte, sondern eventuell Aufzüge oder ähnliches befinden.
Das Für und Wider der Mall muss jeder für sich selbst abwägen und sich so seine Meinung zum »Kaufhaus Viktoria« bilden. Abschließend bleibt jedoch die Frage, wem die Stadt gehört und wer deren Gestaltung mitentscheiden darf. Die Bürgerinitiative »Viva Viktoria!« hat ihre Antwort gefunden und wird diese wohl bis zum bitteren Ende vertreten. ◄